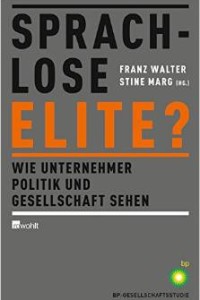Die sozialwissenschaftliche Unternehmerforschung ist in Deutschland noch unterentwickelt, es gibt vergleichsweise wenige Beiträge. In der jüngst im Rahmen der BP Gesellschaftsstudie von den Politikwissenschaftlern Franz Walter und Stine Marg initiierten Studie „Wie Unternehmer Politik und Gesellschaft sehen“ konstatieren die Autoren: „Jenseits wirtschaftswissenschaftlicher Fragestellungen sind vor allem aktuelle empirische Studien über den Unternehmer verhältnismäßig rar.“ (S. 12 f.) Es gehe oftmals eher um die Institutionen und nicht um die Personen. Es gebe nur wenige Beiträge, die sich in der Vergangenheit aus sozialwissenschaftlicher Perspektive dem Unternehmer genähert hätten. (S. 14)
Für die vorliegende Studie wurden 850 Personen kontaktiert und 160 Einzelinterviews durchgeführt. Das ist eine sehr bemerkenswerte Leistung, da der Zugang zu diesen Personen naturgemäß extrem schwierig ist. Das Buch enthält – neben Einleitung und Fazit – acht Beiträge, in denen die Ergebnisse der Befragung vorgestellt werden.
Interessant fand ich vor allem den von Roland Hiemann verfassten Beitrag über „Werdegänge deutscher Wirtschaftsführer“. Die biographischen Narrationen der allermeisten Interviewpartner auf die Frage, wie sie denn in ihre derzeitige Führungsposition gelangt seien, sei sinngemäß so beantwortet worden: „Ach, das war eigentlich alles gar nicht so genau geplant.“ (S. 39) „Wollte man den Großteil der Biographieberichte mit einem Schlagwort überschreiben, bietet sich der ‚Kommissar Zufall‘ an.“ (S. 41).
Allerdings, so fügt der Autor hinzu: „Das Bekenntnis, dass der eigene Karriereweg eines exakten Plans entbehrte, sondern mindestens ebenso von Zufällen und glücklichen Fügungen bestimmt worden sei, sollte also richtig eingeordnet werden, und das in zweierlei Hinsicht: Zum einen sollte es keineswegs als Mangel an Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft, zum anderen schon gar nicht als Kontroll- und Orientierungslosigkeit in Bezug auf das eigene berufliche Schicksal missverstanden werden… Zum anderen vernebelt die Betonung des Zufalls und des Profitierens von Vorgesetzten nicht den hohen Grad an Selbstbestimmtheit und Selbstüberzeugung der Unternehmer, sie scheint vielmehr dessen Ausdruck zu sein.“ (S. 43 f.)
Ich selbst wäre skeptisch, wenn Unternehmer und Manager stark den Zufall oder gar das „Glück“ als Grund für ihren Erfolg anführen. In der Sozialwissenschaft kennt man das Interviewproblem „sozial erwünschter Antworten“, und dies könnte ein gutes Beispiel dafür sein. Schon der Soziologe Helmut Schoeck schrieb: „Ein Sportler, ein Schüler, ein Geschäftsmann, der gerade einen besonders schönen (und für andere neiderregenden) Erfolg errungen hat, sagt einfach, achselzuckend: na, ich hab eben Glück gehabt… Damit, meist unbewusst, sucht er einen möglichen Neid gegen sich zu neutralisieren.“ Wer seinen eigenen wirtschaftlichen Erfolg mit „Glück“ erklärt, erscheint sympathischer als derjenige, der dies beispielsweise mit überlegener Intelligenz oder höherer Kreativität erklären würde.
Ein Mangel der Arbeit ist, dass nicht zwischen Unternehmern und angestellten Managern unterschieden wird. Es handelt sich hier um zwei sehr unterschiedliche Gruppen, die zwar im Alltagssprachgebrauch manchmal „in einen Topf“ geworfen werden, die sich jedoch sowohl von den Verdienstmöglichkeiten wie auch von den Persönlichkeitsstrukturen und dem Karriereweg ganz erheblich unterscheiden.
Wie sehen die Vorstände und Unternehmer die Gesellschaft und wie ist ihr Selbstbild? In ihrem Fazit schreiben die Autoren: „Die Unternehmerschaft sieht sich als ‚gebeutelte‘ Klasse in Deutschland, malträtiert von Umverteilern, Bürokratien, der Krake des Etatismus. Und sie muss sich in einem geistig-kulturellen Klima behaupten, in dem das Credo gilt: ‚Du kannst mehr verlangen, brauchst aber nicht mehr zu leisten.'“ (S. 286) Die Autoren nehmen die dahinter liegenden Probleme nicht so recht ernst. Ihr Einwand lautet, das „Jammern“ sei schon immer „der Gruß der Kaufleute“ gewesen und die eben zitierte Sichtweise der Unternehmer sei wortgleich schon in den 70er Jahre zu beobachten gewesen. Damit ist jedoch, so meine ich, nicht belegt, dass die Kritik unbegründet oder auch nur überzogen sei: In den siebziger Jahren, so wie auch heute, war bzw. ist oft eine feindliche Einstellung weiter Teile der Gesellschaft gegen „Manager“ oder „Reiche“ zu beobachten. Und es gibt gute Gründe, dass die Mehrheit der Unternehmer und Manager derzeit der Politik kritisch gegenübersteht – man denke an Stichworte wie Mindestlohn, Energiewende, Frauenquote usw.
Insbesondere, so konstatieren die Autoren, sehen die Unternehmer und Manager „die Medien“ extrem kritisch: „Nicht Gewerkschaften, nicht sozialdemokratische Parteien, nicht einmal die Linke oder unerbittlich quengelnde NGOs sind die Hauptfeinde der Wirtschaftselite, sondern ‚die Medien‘. Kein Stichwort bringt sie – je höher im Management angesiedelt, umso stärker – mehr in Rage als ebendas: Medien… Nirgendwo sonst fallen die Charakterisierungen und Etikettierungen der Unternehmer so martialisch aus, oft geradezu mit tiefer Verachtung und größter Abscheu ausgespien.“ (S. 315)
Die parteipolitischen Präferenzen überraschen niemanden, der Manager und Unternehmer kennt. Bei der letzten Bundestagswahl wählten 54,9% CDU/CSU, 23% FDP, 14,8% SPD, 5,7% Grüne, und je 0,8% Linke bzw. Piraten. Interessant ist auch die Antwort auf die Frage, was die gleichen Personen bei der nächsten Wahl wählen würden. Die FDP würde um 4% zulegen, die Union um 6,6 Prozent verlieren (S. 308) Fragt man, wie sich Manager und Unternehmer auf einer Links-Rechts-Skala einordnen (von 1 extrem links bis 10 extrem rechts), dann ordnen sich mehr als 50% zwischen 6 und 8 ein, also in der rechten Mitte. R.Z.