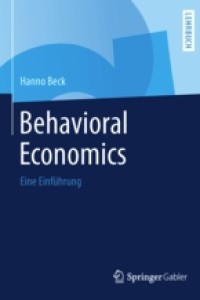„Linda ist 31 Jahre alt, Single, intelligent, offen und hat einen Universitätsabschluss in Philosophie. Als Studentin hat sie sich engagiert für Minderheiten und soziale Gerechtigkeit und war in einer Anti-Atomkraft-Bewegung.“ Bevor Sie weiterlesen, überlegen Sie bitte kurz, was wahrscheinlicher ist: Ist Linda a) eine Bankangestellte oder b) eine Bankangestellte, die sich in der Frauenbewegung engagiert? Wenn Sie mit b) geantwortet haben, dann haben Sie genauso geantwortet wie 85 Prozent der Versuchspersonen, denen man diese Frage vorlegte. Bei kurzem Nachdenken werden Sie merken, dass das natürlich unsinnig ist, weil a) ja den Fall b) als Spezialfall enthält. Das Beispiel steht für viele andere: Die meisten Menschen sind generell schlecht darin, Wahrscheinlichkeiten zu schätzen, insbesondere dann, wenn es sich um zusammengesetzte Ereignisse handelt (S. 35).
Lässt man Spieler in einem Experiment auf den Ausgang eines Würfelspiels wetten, dann zeigt sich ein erstaunliches Verhalten: Sie setzen höhere Summen, wenn der Würfel noch nicht geworfen ist. Liegt der Würfel hingegen, aber das Ergebnis ist noch nicht offengelegt, so sinken die Wetteinsätze. Offenbar glauben die Versuchspersonen unbewusst, sie hätten Einfluss auf den Würfel, was natürlich nicht möglich ist, wenn dieser schon gefallen ist (aber auch eben vorher nicht) (S. 61).
Wir alle tendieren mehr oder minder dazu, Fakten im Sinne bereits vorgefasster Meinungen zu deuten. Eine Gruppe von Studenten sollte einen Fragebogen ausfüllen, um herauszufinden, welche Meinung sie zur Todesstrafe haben. Danach gab man beiden Gruppen, also Befürwortern und Gegnern, die gleiche Literatur zur Todesstrafe. Das Ergebnis: Diejenigen, die vor der Lektüre für die Todesstrafe gewesen waren, gaben an, die Lektüre habe sie in ihrer Meinung bestärkt. Die Gegner der Todesstrafe fühlten sich durch die Lektüre der gleichen Literatur in ihrer Ablehnung ebenfalls bestätigt (S.47). Man spricht hier vom confirmation bias.
Solche Beispiele finden sich viele in dem Buch. Und sie werden auch in der populären Wirtschaftsliteratur häufig zitiert, um zu belegen, dass wir Menschen weit weniger rational handeln, als wir das selbst glauben. Die meisten Leser haben sicher schon einmal Begriffe wie „Behavioral Economics“ oder „Behavioral Finance“ gehört. Aber die meisten haben wahrscheinlich eine unzutreffende Vorstellung, worum es wirklich geht. In populären Medien und Büchern werden die Theorien der „Behavioral Economics“ der Annahme des „Homo Oeconomicus“ entgegengesetzt. Letztere Annahme, so heißt es dann, sei vollkommen wirklichkeitsfremd und inzwischen durch die Forschungsergebnisse der Behavioral Economics widerlegt. Ganz so einfach ist es jedoch nicht, wie Beck in seinem Buch zeigt.
Der große Vorzug dieses Buches ist es, um es vorweg zu bemerken, dass einerseits die Forschungsergebnisse der Behavioral Economics differenziert und ausführlich dargestellt werden, ohne jedoch die Kritik daran zu verschweigen. Die Kritik an den Forschungsergebnissen bzw. an deren Interpretation wird ebenso ausführlicher und fair dargestellt. Dem Autor ist es gelungen, ein Buch des engagierten „Einerseits-andererseits“ zu schreiben, in dem die Annahmen der klassischen Ökonomie gegen allzu pauschale Fundamentalkritik und Missverständnisse in Schutz genommen werden und gleichzeitig die Erkenntnisbeiträge der vergleichsweise neueren Forschungsrichtung der Behavioral Finance angemessen zu würdigen.
Die eingangs beschriebenen Experimente (und viele weitere finden sich in dem Buch) scheinen allesamt die Irrationalität menschlichen Verhaltens zu bestätigen. Der Autor gibt jedoch zu bedenken, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Experimente mit einem solch „überraschenden“ Ausgang in Wissenschaft und Öffentlichkeit Beachtung finden, deutlich größer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass gegenläufige Befunde wahrgenommen werden. Als zweites kommt hinzu: Die sogenannten „Heuristiken“ – also mentale Abkürzungen oder Daumenregeln, die Menschen verwenden, um Entscheidungen zu treffen – sind keineswegs immer unsinnig und müssen der mathematisch korrekten Problemlösungsstrategie (also unter Berücksichtigung von Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Logik) keineswegs stets unterlegen sein.
„Mit Hilfe dieser Heuristiken sind trotz Zeit- und Informationsmangel effiziente Entscheidungen möglich, deren Resultate sich durchaus mit anderen, formaleren Methoden messen können. Sie sind schnell, weil sie nicht auf komplizierten Berechnungen beruhen, und sie sind sparsam, weil sie mit geringen Informationsmengen auskommen und dabei sogar bessere Resultate erzielen können.“ (S. 84). Zu Recht weist der Autor darauf hin, dass viele ökonomische Institutionen oder Handlungsweisen, die Menschen geschaffen haben oder nutzen, nicht durch logisch-konstruktivistisches Denken zustande gekommen sind, sondern in einem spontanen, evolutionären Prozess. „Sie sind nicht auf dem Reißbrett, sondern in jahrhundertelangen Feldversuchen entstanden, und sie haben sich etabliert, weil sie sich als überlegen erwiesen haben.“ (S. 397) Dies, so möchte ich hinzufügen, wusste schon der Nobelpreisträger von Hayek, der vom „verborgenen Wissen“ sprach.
Manchmal kann sogar ein Handeln, das wir für ein Individuum als nicht sehr rational (im Sinne der Übereinstimmung mit Regeln der Logik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung) betrachten würden, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene durchaus nützlich und rational sein. Ein Beispiel ist die Selbstüberschätzung vieler Menschen. Menschen neigen dazu, sich hinsichtlich bestimmter Eigenschaften oder Fähigkeiten besser einzuschätzen, als sie eigentlich sind. So glauben beispielsweise die meisten Menschen, sie seien überdurchschnittlich gute Autofahrer. Bei Befragungen glaubten Studenten, dass sie mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 40% bessere Anfangsgehälter verdienen werden als ihre Kommilitonen, und dass die Wahrscheinlichkeit, vor dem 40. Lebensjahr einen Herzinfarkt zu erleiden, für sie persönlich rund 38% niedriger ist als für ihre Mitstudenten. Ähnliche überoptimistische Einschätzungen finden sich in der Behavioral Economics-Forschung für die Wahrscheinlichkeit von Autounfällen, Lungenkrebs bei Rauchern und der Wahrscheinlichkeit, nicht geschieden zu werden.
Gerade bei Unternehmern habe ich Überoptimismus sehr häufig beobachtet – und zwar zugleich als positive wie als schädliche Eigenschaft, abhängig von der jeweiligen Situation, in der sich das Unternehmen befand. Beck bestätigt diese Sichtweise: „Selbstüberschätzung kann auch motivierend sein, sie fördert Unternehmertum, und sie ermöglicht es den motivierten Unternehmern, andere von ihren Ideen zu überzeugen, beispielsweise Kreditgeber oder Aktionäre. Möglicherweise ist es ja gerade die Selbstüberschätzung und der Überoptimismus, der Menschen zu großen Taten bewegt – sie aber auch scheitern lässt. Wenn von 100 überoptimistischen Menschen nur fünf etwas Bahnbrechendes gelingt, dann hat diese Strategie die Menschheit evolutorisch weitergebracht – auf Kosten der 95 restlichen Überoptimisten, die gescheitert sind. Evolutorisch betrachtet kann Überoptimismus also durchaus sinnvoll sein.“ (S. 68)
Das zeigt: Es ist nicht so einfach mit der „Rationalität“ und der „Irrationalität“. Was bei vordergründiger Betrachtung irrational erscheinen mag, kann bei näherer Betrachtung oder Analyse in einem anderen Kontext durchaus rational sein.
Generell sind Heuristiken nicht nur sinnvoll, sondern unvermeidlich für das Überleben des Menschen. „Der Mensch war in seinen Urzeiten darauf angewiesen, rasch und schnell zu handeln, statt lange zu überlegen, ob es sich beim Rascheln hinter dem Busch um ein harmloses Tier oder einen Feind handelt – also brauchte er schnelle, einfache, unaufwendige Lösungen für solche Situationen. In vielen Situationen wird man nun bei einem Rascheln im Busch fälschlicherweise davonlaufen – aber das eine Mal, wo man richtig handelt, wiegt die vielen anderen vorherigen Fehlentscheidungen auf. Viele Heuristiken sind solche mentalen Abkürzungen.“ (S. 77)
Der Autor zeigt also, dass die Erkenntnisse der Behavioral Economics differenzierter zu interpretieren sind, als es von denjenigen getan wird, die sie einfach als Belege für die Irrationalität menschlichen Handelns werten wollen. Andererseits verteidigt er auch die klassische Ökonomie mit ihrem Modell des Homo Oeconomicus: Niemand sei so dumm, dass er glaube, dass Menschen sich immer oder meistens rational verhielten. Aber es sei dies eine Modellannahme, ohne die man in der Wissenschaft schwerlich auskomme. Und den Behavioral Economics sei es auch bislang noch nicht gelungen, ein wissenschaftlich tragbares Gegenmodell zu entwickeln.
Das Buch ist eine hervorragende Einführung für jeden, der sich mit dem Thema befassen will. Es hat den Vorzug, dass es nicht nur die Forschungsergebnisse und Argumente der Behavioral Economics äußerst kenntnisreich darstellt, sondern ebenso die Gegenargumente – und dann auch wieder die Entgegnungen auf die Gegenargumente. So entsteht im Kopf des Lesers ein sehr fruchtbarer Dialog. R.Z.